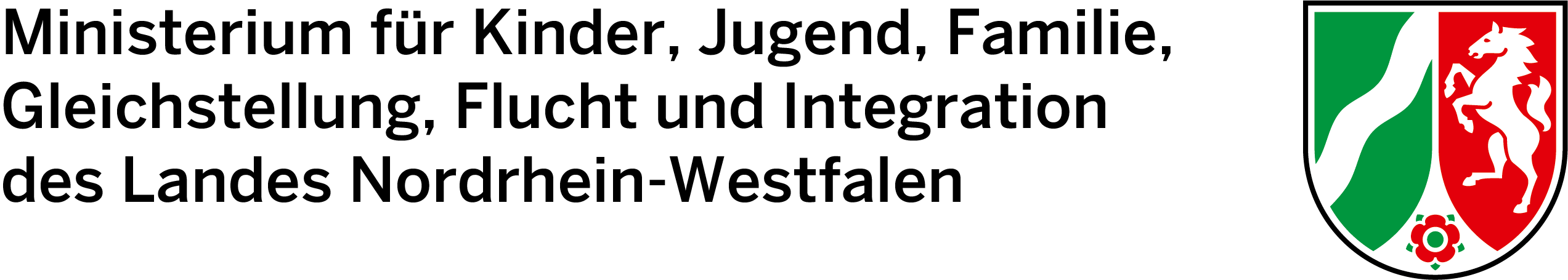Positionen
Tür auf – Kinder und Jugend jetzt!
Positionen der AGOT-NRW für eine starke Offene Kinder- und Jugendarbeit
Offene Kinder- und Jugendarbeit – das bedeutet Spaß und Spannung in Einrichtungen und mobilen Angeboten. Ein wichtiger Baustein hinter einer erfolgreichen Offenen Tür sind engagierte Jugendliche, Ehrenamtliche und hauptamtliche Fachkräfte mit Ideen, Konzepten, Programmen und Positionen.
Wir, die AGOT-NRW, laden Sie und euch dazu ein, Positionen, Ideen und Handlungshinweise der Offene Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen dieser Seite(n) (neu) zu entdecken und sich kritisch damit auseinanderzusetzen.
Wir freuen uns, wenn Elemente dieser Veröffentlichung dazu beitragen, Offene Kinder- und Jugendarbeit weiter zu entwickeln und in der Kommune zu sichern. Darüber hinaus sind wir über Rückmeldungen, kritische Hinweise und inhaltliche Diskurse zu den vorgestellten Positionen dankbar. Viel Spaß bei der Lektüre!